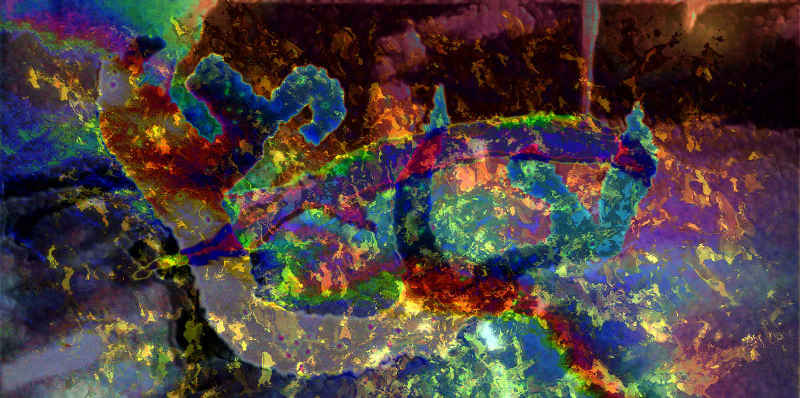
Das Nichts kann kein Etwas sein
Es ist nicht möglich, über das Nichts nachzudenken, ohne es zu einem Etwas zu machen.
Das heißt, es ist gar nicht möglich, über das Nichts nachzudenken. Tun wir es trotzdem, beschäftigen wir uns lediglich mit einer Fantasie, einer Vorstellung, die wir uns vom Nichts machen.
Wir wissen nicht, ob es irgendwo „da draußen“ in irgendeiner unbekannten „Dimension“ (möglicherweise außerhalb oder jenseits des Universums) etwas gibt, das dem entspricht, was wir meinen, wenn wir vom Nichts reden.
Sollte es tatsächlich mehr als ein Ideal oder eine intellektuelle Spielerei sein, handelt es sich vielleicht um ein unbekanntes Existenzprinzip, das jenseits der Räumlichkeit, Zeitlichkeit, Kontinuitäten und Wahrnehmungen verortet ist und sich deshalb unseren Assoziationsmöglichkeiten entzieht.
Deswegen sind all unsere Bemühungen, ernsthaft etwas über das Nichts eruieren zu wollen, zum Scheitern verurteilt.
Die Grenzen unseres Assoziationspotenzials
Allein mit dem, was wir Verstand nennen (einem imaginären Werkzeug, bei dem wir nie wirklich wissen, ob es auch richtig funktioniert), werden wir nie eruieren, wie der Hintergrund des Phänomens der Existenz beschaffen ist, sozusagen die Bühne, auf der die Existenz sich zeigt.
Entfernt man beispielsweise in einem Gedankenexperiment die komplette Existenz (das Universum inkl. Raum und Zeit), bleibt dann etwas zurück, das man als »existenzielles Nichts« bezeichnen könnte?
Sollte es uns irgendwann einmal möglich sein (vielleicht in 10 Tausend Jahren), mit super-superlichtschnellen Raumschiffen den „Ereignishorizont des Universums“ physikalisch aufzusuchen, um dort direkt vor Ort Nachforschungen anzustellen, könnten sich vielleicht echte brauchbare Ansätze zur Erforschung eines realexistierenden Nichts auftun.
Ich kanns mir vorstellen, also gibts das auch irgendwo
Schwarze Löcher verraten sich durch die von ihnen erzeugte Raumverzerrung. Das Nichts besitzt solche Schattenwurfeigenschaften wesensbedingt nicht.
Das Nichts hat seinen Ursprung vielleicht in folgender Assoziation: Da es ein Etwas gibt (die Existenz, das Universum), muss oder könnte es auch das Gegenteil oder einen Gegenpol dazu geben.
Als Motivator, an diese Möglichkeit zu glauben eignet sich die Theorie vom Teilchen-Antiteilchen Konzept in der Physik: Alle Elementarteilchen besitzen ihr persönliches Antiteilchen, einen Gegenpol – warum das Prinzip des Existierens dann nicht auch?
Doch in Anbetracht der Tatsache, dass wir noch nicht einmal wirklich verstanden haben, was ein Etwas ist (also Materie, Raum, Zeit, Energie, aber auch Gedanken, Bewusstsein und auch Wahrnehmung), ist es ziemlich gewagt zu glauben, wissen zu können, was ein Nichts sein könnte.
Die Wahrnehmung des Nichts
Um etwas mit Worten beschreiben zu können, die mehr als theoretische und vermeintlich logische Überlegungen sind, müssen wir dieses Etwas in irgendeiner Form wahrnehmen. Da uns das beim Nichts aber nicht möglich ist, sind unsere Forschungsergebnisse niemals mehr als Theorien. Unser Philosophieren und Nachdenken darüber kann daher nie mehr als das Philosophieren über eine reine Idee sein.
Egal, was auch immer wir tun und welche Systeme, Philosophien, Dialektiken, Ideologien, Glaubensrichtungen, Denkweisen oder Methoden wir benutzen, um das Wesen des Nichts auszuleuchten: Wenn diese Methoden auch bei der Ergründung eines ETWAS funktionieren, taugen sie zur Erforschung des Nichts nichts.
Tatsache ist: Alle Methoden, die uns zur Verfügung stehen, wurden von „Etwas-Wesen“ in einer „Etwas-Welt“ entwickelt. Wenn wir glauben, sie auf etwas anwenden zu können, das der Etwas-Welt nicht angehört, haben wir nicht verstanden, worum es bei der Nichtsforschung geht.
Die Null-Dimension
Die Null-Dimension darf nicht mit dem »nulldimensionalen Raum« verwechselt werden. Dieser ist ein Teilgebiet der Topologie.
Wenn wir uns mit dem Nichts beschäftigen, vergessen wir meistens, dass es sich dabei um ein von uns erdachtes oder postuliertes Phänomen handelt. Denn wir reden nicht deswegen davon, weil wir es gesehen oder sonst wie erfahren haben, sondern weil wir fähig sind, es uns vorzustellen und anschließend mit konstruierten logischen Überlegungen plausibel zu machen.
Um das Nichts besser verstehen zu können, hilft es vielleicht, wenn wir es zu einer Dimension erklären: Denken wir uns zu den drei bekannten räumlichen Dimensionen zwei weitere hinzu, haben wir folgende Hierarchie:
Nullte Dimension:
Nichts — kein Punkt – die Abwesenheit von sämtlich denkbaren Bezugsebenen
Erste Dimension:
Unendlich kleiner Punkt — ein Punkt, so klein, dass er sozusagen im Nichts verschwindet
Zweite Dimension:
Unendlich dünne Linie (erste Dimension des Standardmodells) — zwei (Eck-)Punkte
Dritte Dimension:
Unendlich dünne Fläche (zweite Dimension des Standardmodells) — drei oder mehr (Eck-)Punkte auf einer Ebene
Vierte Dimension:
3‑dimensionaler Raum, Würfel, Pyramide etc. (dritte Dimension des Standardmodells) — vier oder mehr (Eck-)Punkte
Bereits die 1. Dimension (der unendlich kleine Punkt) käme als Kandidat für das Nichts in Betracht, denn etwas »unendlich Kleines« ist genauso wenig vorstellbar wie ein »unendlich Großes« oder »das Nichts«. Trotzdem ist ein unendlich kleiner Punkt mehr als kein Punkt.
Im erweiterten Dimensionen-Modell entspricht das Nichts also der Null-Dimension. Das hilft uns zwar auch nicht weiter, das Wesen des Nichts besser zu verstehen, durch die Einordnung in das hierarchisch aufgebaute Dimensionen-Modell, bekommen wir jedoch einen veranschaulichten Ansatz für dieses unmögliche Unterfangen.
Die Zeit – Dimension oder ewiger Augenblick
Eine Zeitdimension (normalerweise unsere 4., hier wäre sie die 5.) fällt in diesem Modell weg, da nicht eindeutig geklärt werden kann, an welcher Stelle sie in der Rangfolge einzufügen wäre. Denn wenn wir uns beispielsweise eine Flächenwelt (Flatland) vorstellen können, dann nur, weil es auch in ihr, wie im 3‑dimensionalen Raum, einen zeitlichen Ablauf der Geschehnisse gibt.
Die Zeitdimension muss also (oder kann?) keine sein, die erst später hinzukommt. Doch wo genau sie einzufügen wäre, ließe sich ohne weitere Untersuchungen nicht sagen. Deshalb gibt es in diesem Modell auch keine – nötig wäre sie ohnehin nicht. Auch ist bis heute nicht geklärt, ob Zeit überhaupt eine Dimension ist bzw. ob es sie als „Medium“ überhaupt gibt und sie nicht eher so etwas wie ein ewiger Augenblick ist.
Das Spiel mit dem Nichts
Das reale Nichts kann seine Existenz nur in der Nicht-Existenz haben.
Das Nichts kann nur dann wahrhaftes Nichts sein, wenn es nichts ist. Das heißt: Damit es existieren kann, darf es nicht existieren. Das ergibt jedoch keinen Sinn, und so erkennen wir unser Philosophieren darüber als das, was es von Beginn an ist: eine intellektuelle Spielerei.
Andernfalls wäre das Nichts eine andere Art des Daseins, eine uns völlig fremdartige Existenz- oder Energieform, die es noch zu entdecken gäbe (beispielsweise außerhalb des Universums). Doch dadurch wäre es kein wirkliches Nichts. Deswegen ist »das Nichts als ein Etwas« ein Widerspruch in sich selbst.
Eigentlich ist die Beschäftigung mit dem Nichts ausgesprochen müßig. Es gibt Tausende Bücher, die sich damit befassen und bei allen ist das Ergebnis wahrscheinlich das gleiche: Nichts! Doch die Idee, das intellektuelle Konzept vom Nichts, fasziniert uns offenbar. Deswegen haben wir es erdacht.
Wir wissen, dass es ein Etwas (das Universum) gibt, also assoziieren wir uns das Gegenstück, weil wir es (als neugierige Lebewesen) können.
Wir sind fähig, Sätze zu bilden, die keinen Sinn ergeben und wir sind fähig, uns Dinge auszudenken, die es nicht gibt oder keinen Sinn haben. Wir können uns das Nichts denken, also tun wir es auch. Nur aus diesem Grund gibt es das Nichts für uns.
Die polare Logik unseres Denkens
Vielleicht ist auch unsere Neigung, in Polaritäten zu denken, dafür verantwortlich, dass wir uns genötigt fühlen, ein Nichts zu assoziieren: Wir können uns das eine nicht ohne sein Gegenteil vorstellen.
Von Helligkeit können wir nur sprechen, weil es auch Dunkelheit gibt, von Wärme nur, weil es Kälte gibt, von Bewusstsein nur, weil es Unbewusstsein gibt usw. Und auf dieser Logik gründet auch unsere Annahme, dass es das Nichts geben muss oder könnte. „Es gibt ein Etwas, also muss es auch sein Gegenstück geben“, ist unser Gedanke. Doch dabei übersehen wir Folgendes:
Dunkelheit und Helligkeit sind nicht wirklich zwei sich ergänzende, polare Größen oder Werte, die sich gegenüberstehen, denn Dunkelheit besitzt keinen Energiewert – auch keinen negativen. Es gibt eigentlich keine »Dunkelheit«, sondern nur die Abwesenheit von Licht. Diese Abwesenheit nennen wir Dunkelheit. Wenn es nicht so wäre, müsste folgendes Experiment möglich sein:
In einem Raum, indem es weder Dunkelheit noch Helligkeit gibt, müssten wir Helligkeit oder Dunkelheit erzeugen können. Doch das ist nicht möglich, denn schon diesen speziellen Raum gibt es nicht.
Polarität und Scheinpolarität
Das Gleiche gilt für viele andere Polaritäten: Kälte ist nur die Abwesenheit von Wärme, Unbewusstsein die Abwesenheit von Bewusstsein. Dunkelheit, Kälte und Unbewusstsein können nicht erzeugt werden, indem beispielsweise Energie hinzugefügt wird. Diese Zustände bleiben zurück, wenn Licht, Wärme und Bewusstsein entfernt werden. Leere (ein leeres Gefäß) bleibt zurück, wenn wir den Inhalt des Gefäßes entfernen. Andersherum geht es nicht: Wir können keine Leere hineintun oder entfernen, denn wir können mit einem Nichts nicht hantieren, sondern nur mit einem Etwas.
Wir können kein Nichts irgendwo hintun, und damit ein Etwas verdrängen. Deswegen ist es auch nicht möglich, mit einem Etwas ein Nichts zu verdrängen. Wir können nur ein Etwas durch an anderes Etwas ersetzen.
Wir können Kälte, Dunkelheit oder Unbewusstsein nicht hinzutun und haben anschließend dann mehr davon. Wenn man ein Nichts zu einem Etwas hinzutut, ist das Etwas anschließend nicht kleiner. Tausend plus null ergeben immer noch tausend. All das sind vielleicht müßige Gedanken, die allerdings Spaß machen können. Denn alles, was wir uns vorstellen und ausdenken können, macht Spaß, wenn es interessant ist – es muss nicht unbedingt Sinn ergeben.
Diese Analogien zeigen, das Nichts ist gar kein wirkliches Nichts. Irgendjemand hat einmal sinngemäß gesagt: „Alles, was wir uns vorstellen können, gibt es irgendwo und irgendwann im Universum auch.“ Doch bei dieser Behauptung handelt es sich nur um einen Satz, den wir schnell aussprechen, aber nicht verifizieren können.
Alle Theorien über das Nichts werden deshalb (zumindest in absehbarer Zeit) immer Gedankenspiele bleiben. Und so verhält es sich auch mit dem, was ich hier schreibe: Es ist nur ein Spiel.
Das Nichts existiert dort wo Nichts ist und wo der Mensch oder wer auch immer nicht hindenkt.
Das All und das Nichts.
Das All muss alles sein, was wirklich ist. Es kann nichts geben, das außerhalb des Alls existiert, sonst wäre das All nicht das All.
Das All muss unendlich sein, denn es gibt sonst nichts, das All zu definieren, zu beschränken, zu begrenzen.
Es muss unendlich sein in der Zeit oder ewig – es muss immer fortdauernd existiert haben, denn es gibt nichts, von dem es hätte erschaffen werden können – und etwas kann niemals aus nichts entstehen, und wenn es jemals nichts gewesen wäre, nur für einen Augenblick, würde es jetzt nicht sein. Es muss immer, fortdauernd existiert haben, denn es gibt nichts, von dem es zerstört werden könnte. Es kann nie nicht sein, auch nicht nur für einen Augenblick, denn etwas kann niemals nichts werden.
Es muss unendlich sein im Raum, es muss überall sein, denn es gibt keinen Ort außerhalb des Alls, es kann nicht anders als zusammenhängend im Raume sein, ohne Lücken, Aufhören, Trennung oder Unterbrechung, denn es gibt nichts, das seinen Zusammenhang unterbrechen oder trennen könnte, nichts, das die Lücken ausfüllen könnte.
Es muss unendlich sein in der Macht oder absolut, denn es gibt nichts, von dem es begrenzt, eingeschränkt, zurückgehalten, gestört oder bedingt werden könnte – es ist keiner anderen Macht untertan, weil es keine andere Macht gibt.
Genau das, was es jetzt ist – das All – muss es immer gewesen sein und muss es immer bleiben.
Etwas anderes, in das es sich hätte umändern können, hat es nie gegeben, gibt es jetzt nicht und wird es nie geben. Daraus, dass das All unendlich, absolut, ewig und unveränderlich ist, folgt, dass:
ALLES,WAS ENDLICH,BEDINGT,WECHSELND UND FLIEßEND IST,NICHT DAS ALL SEIN KANN. UND DA ES TATSÄCHLICH „NICHTS“ AUßERHALB DES ALLS GIBT,MÜSSEN ALLE UND JEDE ENDLICHEN DINGE IN WIRKLICHKEIT SOVIEL WIE „NICHTS“ SEIN.
Bei den Buddhisten ist das NICHTS oder an Nichts denken eine Meditationshilfe,um sich von Gedanken zu befreien.