
Glaube an alles Mögliche
Religiöser und nicht-religiöser Glaube prägen unser Leben in erheblichem Maße. Oft messen wir unseren imaginierten Werten mehr Bedeutung bei als der realen Welt, denn diese empfinden wir häufig als unzureichend oder unbefriedigend. So erschaffen wir uns verschiedene Glaubenswelten, in denen wir uns auf unterschiedliche Weise bewegen.
Inhalt
Unsere Abneigung gegenüber der nackten Realität ist nachvollziehbar. Das Leben kann hart, enttäuschend und voller Leid sein. Die Flucht in imaginäre Welten erscheint daher als ein naheliegendes Mittel, um Trost oder Sinn zu finden.
Die größte und wohl bedeutendste dieser alternativen Glaubenswelten ist das Jenseits – der religiöse Himmel, eine mythologische Existenzsphäre, von der wir hoffen, sie nach unserem Tod betreten zu können. Diese Vorstellung spendet Trost und kann dazu beitragen, unser Leben trotz innerer Leere oder existenzieller Zweifel nicht vorzeitig zu beenden.
Glaube, Hoffen, Wünschen
Irgendjemand sagte einmal sinngemäß: „Würden wir mit absoluter Sicherheit wissen, dass es kein Leben nach dem Tod gibt, würde sich jeder Zweite das Leben nehmen.“ Denn wozu eine unbefriedigende und quälende Existenz lebenslang aushalten, wenn sich diese Strapaze sowieso nicht auszahlt?
Wir halten dennoch durch, weil wir auf eine bessere Existenz nach dem Tod hoffen und zugleich die möglichen Konsequenzen fürchten, die ein vorzeitiges Ende mit sich bringen könnte. Die Aussicht auf Belohnung oder die Angst vor Bestrafung beeinflussen unser Verhalten mehr, als wir uns oft eingestehen wollen.
Der Glaube, dass es Wissen ist
Die einen glauben an einen Gott, die anderen daran, dass es keinen geben kann. Wieder andere glauben an Außerirdische, UFOs, Geheimbünde oder Weltverschwörungen.
Manche setzen ihr Vertrauen in Sagen und Mythen, politische Ideologien, Determinismus oder das Schicksal. Selbst wer behauptet, an nichts zu glauben, glaubt möglicherweise an die Wissenschaft oder den Rationalismus. Viele sind überzeugt, den Durchblick zu haben – während alle anderen als gehirngewaschen, verblendet oder ignorant gelten.
All diese Glaubensformen haben eines gemeinsam: den Glauben, dass es sich dabei um Wissen handelt. Doch in Wirklichkeit sind es nur Überzeugungen – und die müssen nicht zwangsläufig richtig sein. Unsere bestechende Logik lautet oft: Da ich es glaube, ist bewiesen, dass es wahr sein muss, denn wäre es das nicht, würde ich es auch nicht glauben!
Wir gehen davon aus, so etwas wie einen inneren Wahrheitsdetektor zu besitzen. Dieser verleiht uns – zusammen mit unserem gesunden Menschenverstand – die Fähigkeit, als Laien komplexe Themen besser beurteilen zu können als Experten, die sich jahrzehntelang intensiv damit beschäftigt haben.
Die Abwehrreaktion
Unsere Selbstüberschätzung resultiert aus unserer Unfähigkeit, Gedanken und Meinungen angemessen zu relativieren und in Beziehung zu anderen Sichtweisen zu setzen. Halten wir unseren Glauben – ob religiös oder nicht – für eine apriorische Wahrheit, fehlt uns oft die Bereitschaft oder Fähigkeit, ihn kritisch zu hinterfragen. Warum sollten wir das tun? Schließlich ist er unser Glaube – das muss reichen. Doch letztlich handelt es sich dabei nur um eine Form der Selbsthypnose.
Macht man uns darauf aufmerksam, dass „Glaube“ eine Annahme oder Vermutung ist – je nach Temperament vielleicht auch eine Hoffnung, Überzeugung oder Wunschprojektion –, stimmen wir dem vielleicht zu, jedoch mit der Einschränkung, dass unser eigener Glaube eine Ausnahme darstellt.
Natürlich verteidigen wir ihn mit allen Mitteln. Ohne ihn fühlen wir uns orientierungslos oder gar schutzlos in der Welt. Die Vorstellung, unsere Überzeugungen könnten bloß eine Form des Wünschens oder Hoffens sein, missfällt uns. Daher vermeiden wir eine tiefere Auseinandersetzung mit ihnen – eine analytische Diskussion mit uns als Glaubenden wird somit unmöglich.
Angst vor der Ernüchterung
Doch wenn unser Glaube tatsächlich wahr wäre, hätten wir keinen Grund zur Angst, ihn auf die Probe zu stellen – das müsste uns als intelligente Glaubende klar sein. Wir sollten diese Grenze freudig überschreiten, um seine Wahrhaftigkeit zu beweisen und anderen Menschen näherzubringen – egal ob mit oder ohne Sendungsbewusstsein.
Eine Analogie verdeutlicht diesen Widerspruch: Ist ein Mathematiker von der Richtigkeit einer Formel überzeugt, wird er sie auch verifizieren. Weigert er sich, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass er ihre Fehlerhaftigkeit fürchtet.
Tief in unserem Inneren wissen oder ahnen wir, dass unser Glaube auf überlieferten Mythen oder fixen Ideen basiert. Doch diese Einsicht vermeiden wir bewusst. Auf lange Sicht jedoch behindert uns diese Verweigerungshaltung in unserer persönlichen Entwicklung.
Glauben ist Ersatzwissen
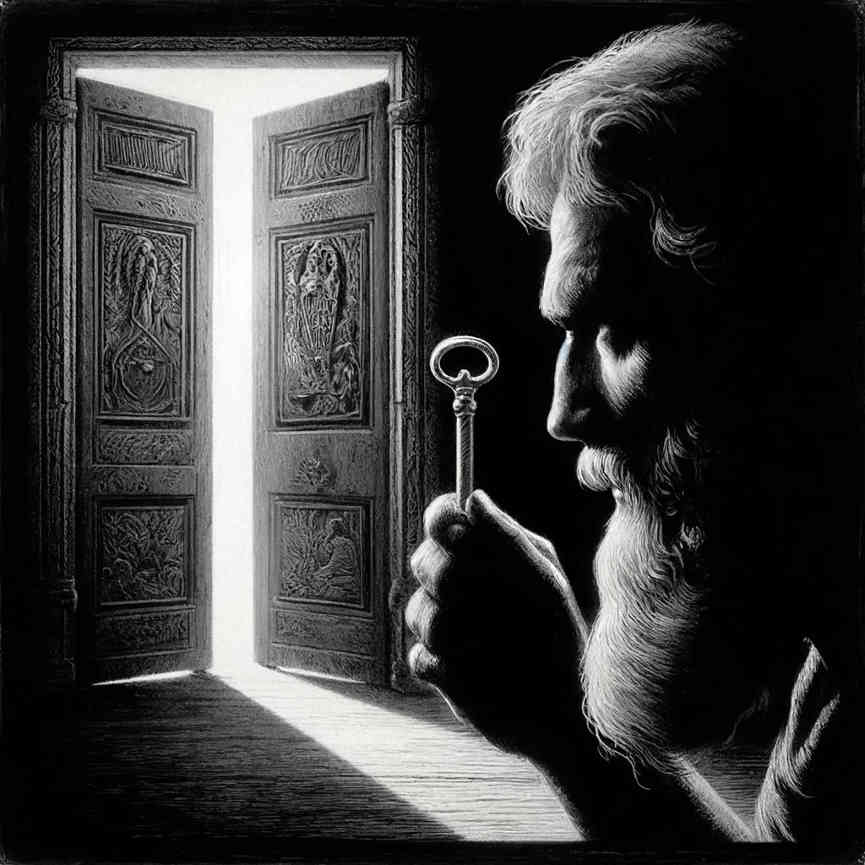
Glauben wir an etwas, treffen wir eine Annahme, vermuten oder vertrauen auf das, was nicht bewiesen werden kann. Oder wir halten eine vergangene Tatsache heute noch für gegeben, obwohl wir das definitiv nicht wissen können. Wir sind von etwas überzeugt, das sich nicht beweisen lässt.
Diese Überzeugung muss sich nicht auf religiöse oder spirituelle Inhalte beziehen. Sie kann auch alltägliche Dinge betreffen – den Glauben an die Treue des Partners, an die Sicherheit des eigenen Jobs oder daran, dass unser Auto in der nächsten Stunde keinen Motorschaden erleidet. Doch sicher wissen wir nichts davon.
Praktisch betrachtet unterscheidet sich Alltagsglaube nicht von religiösem Glauben. In beiden Fällen handelt es sich um Spekulationen, unabhängig vom Grad der Wahrscheinlichkeit. Der Alltagsglaube bezieht sich auf weltliche Themen (Job, Partnerschaft, Auto), der religiöse auf mythologische oder überlieferte Vorstellungen. Während der Alltagsglaube oft von Mutmaßungen und Wahrscheinlichkeiten geprägt ist, speist sich der religiöse eher aus Hoffnungen, Wünschen und Ängsten.
Stabilitätsfaktoren und Orientierungshilfen
Unser Alltagsglaube hilft uns, in unsicheren Situationen bessere Entscheidungen zu treffen. Den religiösen Glauben nutzen wir, um die Tristesse und Trostlosigkeit des Alltags besser zu ertragen.
Religiöser Glaube ist eine überlieferte Tradition, die wir in unserer Kindheit – einer Lebensphase, in der wir besonders leicht beeinflussbar sind – unreflektiert übernehmen. Welchen Glauben man uns auch lehrt (christlich, jüdisch, islamisch, hinduistisch, buddhistisch) – wir nehmen ihn an, weil wir als abhängige, unmündige Kinder keine Alternative haben.
Doch da unser Leben oft von Anstrengung, Leid, Arbeit und Entbehrung geprägt ist, erscheint uns die Idee einer höheren Sinngebung mit der Zeit immer attraktiver – selbst wenn wir sie nicht wirklich ernst nehmen. In dieser Funktion dient religiöser Glaube als Stabilisator und ist nach wie vor notwendig, um unsere von Widersprüchen durchzogene Gesellschaft vor dem Zerfall zu bewahren.
Grenzen des Wissens
Wenn wir über bestimmte existenzielle Aspekte des Lebens nichts wissen – weil es unmöglich ist, darüber etwas wissen zu können –, empfinden viele von uns Unzufriedenheit oder eine unterschwellige Unruhe, manchmal sogar Angst.
Wir stoßen an die Grenzen unseres Intellekts oder Geistes und werden mit der Tatsache konfrontiert, dass es Dinge gibt, die sich unserer Wahrnehmung und unserem Urteilsvermögen entziehen. Das frustriert uns – bewusst oder unbewusst –, denn das Unbekannte können wir weder beeinflussen noch kontrollieren. Dieser Kontrollverlust kann unser Selbstwertgefühl erschüttern, weil er bedeutet, dass wir nicht in allen Belangen des Lebens souverän sind.
Wer sich mit dieser Einschränkung nicht abfinden kann oder will, neigt dazu, diese Wissenslücke mit Ersatzwissen zu füllen.
Glaubenssysteme, Utopien und Esoterik
Dabei kommt es nicht darauf an, ob dieses Ersatzwissen einem wirklichen Wissen ebenbürtig ist. Es soll uns lediglich vergessen lassen (oder darüber hinwegtäuschen), dass es in der Welt Dinge gibt, die sich unserer Wahrnehmung und Einflussnahme entziehen.
Glaubenssysteme müssen dabei nicht zwangsläufig religiöse oder spirituelle Hintergründe haben. Politische Ideologien und Utopien können ebenso eine Ersatzfunktion erfüllen. Wer nicht an das Jenseits, an Gott oder Engel glaubt, setzt seinen Glauben vielleicht in die Wissenschaft, den Kommunismus, den Nationalismus oder eine Verschwörungstheorie – irgendetwas zum Glauben findet sich immer.
Manche unserer Utopien oder Fantasien spielen in der Zukunft oder alternativen Welten, denn oft dient unser Glaube dazu, uns von der Gegenwart – also der Realität – abzulenken.
Glauben: eine höhere Art des Wissens
Da es sich in all diesen Fällen um kein wirkliches Wissen handelt – denn Wissen basiert stets auf beobachtbaren, also direkt wahrnehmbaren Dingen, Zuständen oder Zusammenhängen, die deshalb als Fakten gelten –, empfinden wir diesen Mangel als unangenehm. Um ihn zu kaschieren, etikettieren wir unseren religiösen Glauben als metaphysisches oder gefühltes Wissen und unseren atheistischen als Rationalwissen oder schlicht als Wissenschaft.
Wir behandeln unseren Glauben als eine höhere Form des Wissens, als eine apriorische Wahrheit, die keinen Beweis oder keine Überprüfung benötigt. Das macht ihn immun gegen Kritik. So fällt es uns leicht, an das zu glauben, was uns hilft, unsere innere Unruhe und unseren latenten Unmut zu besänftigen.
Wir müssen nur fest an etwas glauben und davon überzeugt sein – und schon scheinen Unruhe und Unmut verschwunden. Doch in Wahrheit haben wir sie nur betäubt.
Grenzen des Glaubens
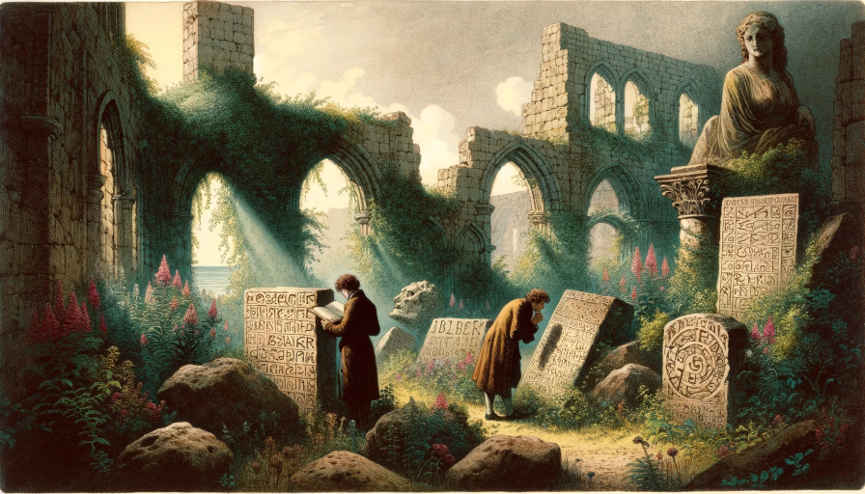
Oft sind wir überzeugt, die Wahrheit zu kennen und im Recht zu sein – und liegen trotzdem total daneben.
Manche Dinge können wir wissen – und wissen sie daher auch. Andere können wir nicht wissen und sind sie uns dann wichtig, müssen wir sie glauben. Dann gibt es drei Möglichkeiten: Unser Glaube entspricht der Realität, er tut es nicht, oder er trifft nur teilweise zu. Wahrscheinlich verbringen wir den Großteil unseres Lebens im dritten Zustand – im festen Glauben, im ersten zu sein.
Wir haben unser Auto an einer bestimmten Stelle geparkt. Wir wissen, dass wir es gestern dort abgestellt haben. Also sind wir überzeugt, dass es noch immer dort steht. Warum sollten wir etwas anderes annehmen?
Doch dieses Wissen ist kein wirkliches Wissen. Denn unser Auto könnte inzwischen gestohlen oder abgeschleppt worden sein. Das ist zwar höchst unwahrscheinlich, und mit großer Sicherheit werden wir es am nächsten Tag dort wiederfinden, wo wir es am Abend zurückgelassen haben. WISSEN werden wir es jedoch erst, wenn wir tatsächlich davorstehen.
Es ist schon vorgekommen und passiert immer wieder: Dort, wo ein Auto am Abend stand, steht es am nächsten Morgen nicht mehr, eben weil es gestohlen oder abgeschleppt wurde. Wir glaubten also nur zu wissen, wo unser Auto steht.
Die Vorstellungswelt aufbrechen
Es bedeutet also nicht viel, von etwas überzeugt zu sein. Was uns als Wissen erscheint, ist oft nur eine Annahme, die auf unzureichenden Informationen beruht.
Da uns diese Einschränkung meist nicht bewusst ist, haben wir keinen Grund, an unserem vermeintlich sicheren Wissen zu zweifeln. Solange wir nichts vom Diebstahl unseres Autos wissen, erscheint uns unsere Überzeugung als Wissen – obwohl sie es längst nicht mehr ist. Unser Wissen ist oft nur eine Illusion.
Das heißt natürlich nicht, dass wir aufhören sollten, uns auf unsere Gefühle und Vermutungen zu verlassen – das wäre töricht. Doch wir sollten uns nicht von unseren Überzeugungen abhängig machen, denn das wäre noch viel törichter. Im Alltag spielt das oft keine große Rolle, denn Irrtümer gehören zum Leben dazu. Sie können uns sogar bereichern, indem sie neue Perspektiven eröffnen und unerwartete Impulse setzen.
Bei fundamentalen und weltbewegenden Fragen ist jedoch Vorsicht geboten. Hier ist es klüger, unsere Überzeugungen mit Distanz zu betrachten. Diese Haltung bewahrt unsere Offenheit, hält unseren Geist beweglich und verhindert eine Verhärtung oder gar Fanatisierung unserer Denkweise.
Doch allzu oft sind wir in einer vordefinierten Vorstellungswelt gefangen. Diese müssen wir durchbrechen, wenn wir kreative, emanzipierte und verantwortungsbewusste Menschen sein wollen.
Der Fluch des Wissens

Nur zu glauben, weil wir uns nicht zu wissen trauen, ist töricht. Denn das, was wir aus Angst vor dem Wissen nicht wissen, existiert ja trotzdem.
Bewusste und unbewusste Ängste treiben uns dazu, an Religionen, Ideologien oder Esoterik zu glauben. Ein schöpfergottgläubiger Mensch etwa führt die Existenz des Universums und des Lebens auf das Wirken eines übernatürlichen Wesens zurück. Doch damit entmystifiziert er das Phänomen der Existenz – er rationalisiert es für sich. In Wahrheit fürchtet er sich vor dem, was tatsächlich dahinterstecken könnte.
Doch auch Atheisten verfahren ähnlich. Sie suchen in der Wissenschaft nach einer beruhigenden Erklärung für das Rätsel der Existenz. Ihre Welt- und Existenzerklärungsmodelle vermitteln ihnen ein Gefühl von Kontrolle und Sicherheit, sodass sie sich ungestört ihrem Alltag widmen können.
Unsere Sinnsuche – sei es im Übersinnlichen oder in der Wissenschaft – zeigt letztlich, dass uns das Phänomen der Existenz selbst kaum interessiert. Wir haben die eigentliche Ausgangsfrage gar nicht verstanden: Warum gibt es überhaupt etwas? Warum gibt es nicht nichts?
Antworten wie „Gott“ oder „Wissenschaft“ greifen zu kurz. Sie befriedigen uns nur, weil man uns beigebracht hat, uns mit ihnen zufriedenzugeben. Solange wir mit den Vorstellungen „Gott hat alles erschaffen“ oder „Das Universum ist aus dem Nichts entstanden“ (der Ausdifferenzierung der mathematischen Null) zufrieden sind, begnügen wir uns mit der zweiten Wahl.
Placebowissen
Angenommen, ein göttlicher Schöpfungsakt hätte das Universum hervorgebracht – das Phänomen der Existenz Gottes wäre damit nicht geklärt. Und selbst wenn allein die Naturgesetze verantwortlich wären, wüssten wir immer noch nicht, was diese Gesetze eigentlich bedeuten. Unsere Welterklärungssysteme sind letztlich nur Placebowissen.
Wer ein reiches und erfülltes Leben führen will, muss selbst etwas dafür tun – eigene Interessen entwickeln, kreativ tätig sein. Doch das fällt vielen schwer. Kreativität und Fantasie sind Herausforderungen, denen wir meist nicht gewachsen sind. Also bleiben wir beim Altvertrauten, bei dem, was man uns überliefert hat – sei es eine Religion oder die Ablehnung derselben.
Überlieferte Glaubenssätze unreflektiert zu übernehmen, ist bequem. Sie haben sich über Jahrhunderte oder gar Jahrtausende erhalten – also muss doch etwas Wahres daran sein, denken wir. Und tatsächlich helfen sie uns, die unangenehmen Aspekte des Lebens auszublenden – eine Eigenschaft, die wir nur zu gern schätzen.
Doch tief in uns sitzt ein unbewusstes Misstrauen gegenüber dem Wissen – über uns selbst, über die Welt und über das Leben als solches.
Glaubensenergie
Es gibt eine kreative Art des Glaubens, die keine Flucht vor dem Wissen ist: Optimismus.
Müssen wir unter Zeitdruck dringend irgendwo hin, ohne den kürzesten Weg zu kennen, aber zumindest die grobe Richtung, wäre es unsinnig zu resignieren und zu sagen: „Solange ich nicht weiß, welches der schnellste Weg ist, mache ich mich gar nicht erst auf den Weg.“
Das wäre dumm – denn so nähmen wir uns die Chance, unser Ziel doch noch rechtzeitig zu erreichen. Stattdessen ist es sinnvoller, pragmatisch vorzugehen:
Wir wählen eine Strecke, von der wir glauben, dass sie die schnellste ist. Während wir unterwegs sind, halten wir an diesem Glauben fest – er motiviert uns, zügig voranzukommen. Vielleicht haben wir nicht den optimalen Weg gewählt, doch allein die Überzeugung, auf dem besten zu sein, kann uns beflügeln. Und so erreichen wir unser Ziel möglicherweise doch noch rechtzeitig.
Ohne diesen Glauben hätten wir uns vielleicht nicht genügend beeilt. Eine optimistische Einstellung – auch wenn sie manchmal den Charakter eines blinden Glaubens hat – kann in bestimmten Situationen also tatsächlich von Vorteil sein.
Ähnlich verhält es sich in vielen anderen Lebensbereichen: Der feste Glaube an das Gelingen eines Vorhabens kann einen positiven Einfluss auf das Ergebnis haben. Entscheidend ist jedoch, dass unser Glaube kein Wunschdenken unterstützt. Wer überzeugt ist, eines Tages reich und berühmt zu sein, wird höchstwahrscheinlich enttäuscht werden. Wer hingegen daran glaubt, dass sein Engagement im Beruf oder Alltag das eigene Leben bereichern kann, wird damit vermutlich recht haben.
Positives Denken ist eine wertvolle Motivationstechnik – doch es hat Grenzen. Wir dürfen nicht dem Irrtum verfallen, dass alles möglich wird, nur weil wir es uns intensiv genug wünschen. „Wenn ich es nur wirklich will, dann wird es geschehen“ – diese Idee mag verführerisch sein, doch in den meisten Fällen ist Erfolg kein Produkt von Affirmationen, sondern von Zufall, Talent oder harter Arbeit.
Unsere Glaubensenergie sollten wir also kreativ und bewusst einsetzen – als Werkzeug, nicht als Illusion.
Hallo Michael,
coole Seite von dir. Was mich bzgl. dem Thema Glauben zur Zeit interessiert ist eine Antwort auf die Frage: Kann man aus dem Nichtglauben an eine Lehre eine Schlussfolgerung ziehen? Würde gerne deine Meinung bzw. Herleitung zu dem Thema wissen. Danke
Hallo Muc
Danke für deine interessante Frage, die mich zu folgenden Gedanken animiert hat.
Frage: Kann man aus dem Nichtglauben an eine Lehre eine Schlussfolgerung ziehen?
Zunächst:
Lehren vermitteln Wissen, Erfahrungen, Erkenntnisse, Philosophien und Ideen. Diese können ganz oder teilweise richtig oder falsch sein. Eine Lehre, die zumindest in ihrem Kern richtig ist, wird auch unser Denken und Leben besser, zukunftstauglicher und kreativer machen. Eine Lehre, die in ihrem Kern nicht richtig ist, besitzt diese Eigenschaft nicht – höchstens zufällig oder über Umwege: Manchmal verfolgen wir ohne es zu wissen eine falsche Idee, die dann doch zum richtigen Ziel führt. Eine Formel oder Handlungsweise kann zwar falsch sein, doch indem wir sie bis zu Ende denken, erkennen wir neue und weiterführende Aspekte unserer ursprünglichen Fragestellung.
Meistens verlassen wir den Pfad unserer falschen Ideen jedoch nicht und halten ein Leben lang an ihnen fest. Deswegen ist es sinnvoll zwischen rationalen und irrationalen Lehren zu unterscheiden. Beide haben ihre Berechtigung. Die irrationalen können jedoch destruktive Auswirkungen haben (im Sinn einer Irrlehre) und sollten deshalb gesondert behandelt und kritisch betrachtet werden.
Die Antwort auf die Frage nach der Schlussfolgerung muss deshalb in zwei Teile aufgesplittet werden:
Der „Nichtglauben“ an rationale Lehren (beispielsweise Naturwissenschaften) könnte als Verweigerung modernen Wissens bezeichnet werden, der Nichtglauben an irrationale Lehren (beispielsweise Religion) als die Loslösung von den überlieferten Assoziationen unserer archaischen Vorfahren und als Voraussetzung für einen offenen Blick für die Anforderungen einer modernen, zukünftigen Welt.
Das ist jedenfalls das, was mir auf die Schnelle zu diesem Thema einfällt.